 Manchmal muß man auf Kommentare eine Antwort geben, die den Rahmen eines Kommentars sprengen. Daher also hier mein Kommentar auf CarlBrandner:
Manchmal muß man auf Kommentare eine Antwort geben, die den Rahmen eines Kommentars sprengen. Daher also hier mein Kommentar auf CarlBrandner:
„Richtig ist: eine Geldeinheit hat immer die Eigenschaft eine Verbindlichkeit von einer Geldeinheit zu tilgen (da erübrigt sich die Definition eines realen Wertbegriffs).“
Das ist ja noch nicht die ganze Geschichte, denn die Funktion von Geld ist es ja gerade das Kostenvolumen mit dem (unsicheren) realen Output in Beziehung zu setzen. (Das ist die Jesse James Geschichte.) Das Kostenvolumen ist eine monetäre Größe mit der Einheit EURO (oder whatever), während der Output eine Stückgröße ist, woraus die Preiskalkulation eine Relation erzeugt, deren Dimension „Geldeinheiten pro Stück“ sind, also das, was man überall als Geldpreis wiederfinden kann. Wegen DIESER Verklammerung von Input (in Geld gemessen) und Output (in Geld kalkuliert) sowie der Maßgabe, daß das erwartete Erlösvolumen (€ pro Stück multipliziert mit Stück gleich Angebotsvolumen vermehrt um die Gewinnspanne) die laufenden Kosten sowie die Finanzierungskosten abdecken soll ergibt sich, daß Geld als ein relatives Maß der geldfinanzierten Produktion anzusehen ist. Das ist nämlich der Clou, weil relative Maße die Dimension dessen, was sie abbilden sollen, nicht selber haben müssen.
Das ist aber der Unterschied zu einem absoluten Maß: ein absolutes Maß muß diejenige Eigenschaft, die sie messen soll, selbst aufweisen. So ist die Eigenschaft des Urmeters gerade die eine Länge zu definieren, die seit der Definition den Namen „Meter“ trägt – eben die Länge, die der Urmeter aufweist. Das was gemessen werden soll und das was das Maß darstellt sind beides identische Dinge mit der Einheit „Meter“.
Dagegen ist Geld gerade kein Maß für „Wert“ und muß es auch nicht sein, weil es lediglich auf die Relation dessen ankommt, was auf der Inputseite als „Kosten“ verzeichnet wird, während sich dieses Kostenvolumen vermittels der Preiskakulation auf der Outputseite wiederfinden. Daß man die Input- und die Outputseite mit Hilfe eines absoluten „Wertmaßstabes“ nicht kommensurabel machen kann ist ein Ergebnis des 200jährigen Ringens um eben diese Lösung. (Man könnte auch sagen, die dahingehend gemachten Versuche waren schlichtweg erfolglos!) Denn die „Integration von Wert- und Geldtheorie“ zieht sich als Erklärungsproblem durch die ökonomische Theoriegeschichte, ob als Gold (wie z.B. bei Marx und den Austrians) oder als „Geldgut“ oder auch ’numeraire‘ (Debreu, Arrow, Hahn) bis hin zur Quantitätstheorie, die das reziproke Preisniveau zum „Wert“ des Geldes stilisiert. Dabei ist diese Geschichte eigentlich schon vor über 100 Jahren geklärt worden:
“Indem also zwischen den Quanten des einen und denen des anderen Faktors ein konstantes Verhältnis besteht, bestimmen die Größen des einen die relativen Größen des anderen, ohne daß irgendeine qualitative Beziehung oder Gleichheit zwischen ihnen zu existieren braucht. Damit ist das logische Prinzip durchbrochen, das die Fähigkeit des Geldes, Werte zu messen, von der Tatsache seines eigenen Wertes abhängig zu machen schien.“ Simmel (1907)
Läßt man einfach den Unsinn beiseite dem Geld (makroökonomisch gesehen) durch alle möglichen Konstruktionen irgendeinen „Wert“ andichten zu wollen, lösen sich auch alle damit verbundenen Widersprüche in einem logischen Rauchwölkchen auf. Damit ist beispielsweise die Frage nach der Motivation von Kredit auch anders zu beantworten, weil Geld als Nicht-Wert, welches nicht unter einer Mengenrestriktion steht, in keiner Weise zu einer persönlichen Vermögensvermehrung beitragen muß (mal abgesehen davon, daß man sich immer klarmachen muß, daß es kein gesellschaftliches Nettogeldvermögen gibt). Kredit bedeutet demnach die Ingangsetzung sozialer Schaffensprozesse, deren Ergebnis – in Geld bepreist – zu einer Verbesserung der allgemeinen Konsummöglichkeiten führt – falls nicht, werden die „zu Unrecht“ vergebenen Kredite einfach gegen die Zinseinnahmen der „erfolgreichen“ Produktionsprozesse gegengerechnet, wodurch sich ein monetäres Gleichgewicht in einem dynamischen Kontext herstellen kann.
Damit wird aber die Frage von Bonität bzw. die Frage nach der Schuldenbedienungsfähigkeit zu der zentralen Kategorie einer Geldwirtschaft. Damit kann man auch die Frage, warum sich heutzutage alles ums Geld dreht dahingehend beantworten, daß das Finanzsystem die zentrale Steuerungsinstanz eines Produktionssystems darstellt, wo nach monetären Kriterien bemessen wird, welche Produktionsprozesse erfolgen dürfen und welche nicht. Die Frage nach einem „Nutzen“ für die „Gesellschaft“ stellt sich in diesem Sinne somit nicht mehr – nur noch die Frage nach der Bonität. Das mag man bedauern, jedoch: ein (auch nur halbwegs) funktionierendes Steuerungssystem wird man nicht so einfach zugunsten irgendwelcher „Werte“ abschaffen können. Es ist natürlich nicht auszuschließen, daß unsere „Standard“-Ökonomen, die als „Wertspezialisten oder -experten“ ausgebildet wurden nicht irgendeinen Unfug anrichten und mal wieder eine Krise verursachen. Zu einem Untergang des (notwendigerweise) abstrakten Geldsystems wird es jedoch dennoch nicht kommen. Hardware funktioniert halt ohne Software nicht – crash hin oder her!
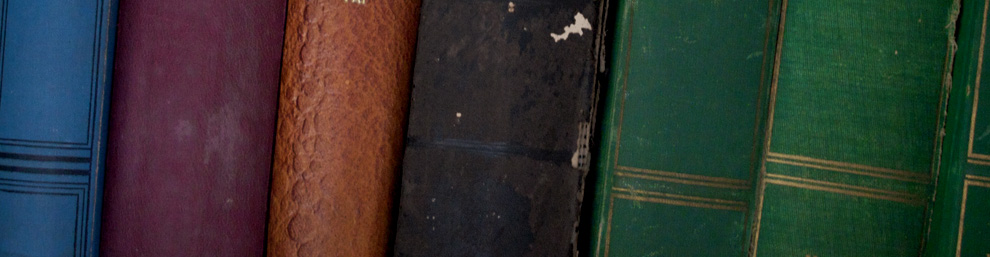
Georg Simmel gehört wegen der freien Verfügbarkeit in allen Formaten genannt :
http://www.digbib.org/Georg_Simmel_1858/Philosophie_des_Geldes
Bilanzierung einer Geige aus französischer Bauerschule auf der Aktivseite, die durch Verbindlichkeiten aus Kredit gegengebucht werden kann.
Preis der Geige ? Höhe der Schuld ?
Sehr geehrter Herr Menendez,
Ihre Botschaft vom Geld ohne „Wert“ (als blosse soziale Verpflichtungsrelation) höre ich wohl, alleine mir fehlt der Glaube! Blicken wir doch auf das Kreditgeld vom abstrakt möglichsten Standpunkt aus, der da heisst: Ein konsolidierter Unternehmenssektor, ein konsolidierter Haushaltssektor, kein Staat, kein Aussen, kein Bankensystem. Dann entsprechen die Aktiva des Unternehmenssektors (A) seinen Schulden (FK) plus seinem Eigenkapital (EK), also: A = FK + EK. Die Schulden des Unternehmenssektors wiederum entsprechen den Forderungen der Haushalte, ihrem sogenannten „Geldvermögen“ (G): G = FK, und das Aktienvermögen der Haushalte (AV) dem Eigenkapital des Unternehmenssektors: AV = EK. Was aber nichts anderes heisst: als dass das Geldvermögen und Aktienvermögen der Haushalte durch die Aktiva des Unternehmenssektors „gedeckt“ sind, also: A = FK + EK = G + AV. Ihre Sichtweise, wonach kein „realer Wert“ des Kreditgeldes existiert, ist daher auf das Deutlichste zurückzuweisen. Die einzige Frage, die sich stellt, lautet: Um welche Art von „Deckung“ handelt es sich hier? Jeder weiss, dass Aktiva des Unternehmenssektors nur solange einen Wert haben, solange sie auch aktiv sind. Dass also im Konkursfalle, der mit temporärer Brachlegung des Unternehmens verbunden ist, der Verkauf der Aktiva für gewöhnlich deutlich unter dem veranschlagten Wert bleibt. Wir haben es also mit einer „Deckung“ des Kreditgeldes exakt in dem Sinne zu tun, dass, solange die Produktion läuft, die Geldvermögen (und das Aktienvermögen) der Haushhalte durch die Aktiva der Unternehmen als realer Wert „bestätigt“ werden. Nicht mehr, aber auch: NICHT WENIGER.
Mit freundlichem Gruss
Alfred Felsberger
Dass man die „Kreditgeldtheorie“ mit der „Preistheorie“ nicht versöhnen kann, liegt letztendlich nur daran, dass die Preisgestaltung der Unternehmen in einem Kreditgeldsystem im höchsten Ausmass dynamisch und pragmatisch zugleich ist. Sagen wir, der Unternehmenssektor hätte 200 GE Löhne und 100 GE Gewinne an die Hauhalte ausgeschüttet, dann besteht seine Aufgabe nicht darin, wie die Ökonomen meinen: den Preis zu suchen, wo sich das Lager leert und die gesamte Produktion abgesetzt wird. Sondern: die Preise in einem dynamischen Verfahren so festzulegen, dass das gesamte vorgeschossene Geld (300 GE) wieder eingetrieben wird OHNE dass sich das Lager vollständig leert. Das Residuum an Waren ist der thesaurierte Unternehmensgewinn. Die Preise übernehmen also keinesfalls die Funktion nach einer Suche der Räumung des Marktes, sondern bloss: die der Suche nach dem Gewinn („der übriggebliebenen Waren“). Eine solche Preistheorie kann mathematisch nicht formuliert werden, was aber noch lange nicht heisst: dass sie nicht existiert.
Mit freundlichem Gruss
Alfred Felsberger
Sehr geehrter Herr Felsberger,
warum fehlt Ihnen der Glaube? Sie schreiben doch selbst, daß Geld eine „soziale Verpflichtungsrelation“ ist! Soweit wie ich Ihre Kommentare kenne, muß ich doch annehmen, daß Ihnen sehr wohl bewußt ist, daß Verpflichtungsrelationen nicht mit dem Instrumentarium der Werttheorie behandelbar sind. Denn Werttheorie ist immer davon geprägt, daß eine Sache in ihrer Bedeutung stets und ständig daran gemessen wird, daß es eine andere Sache gibt, die den Maßstab dafür liefert, was diese Sache „wert“ ist. Werttheorie geht immer um relative „Nutzenverhältnisse“. Genau das hat doch auch Marx zum Wahnsinn getrieben, weil er es nicht auf die Reihe bekommen hat, auf welche Art und Weise man das Tauschmittel Gold mit der von ihm definierten Wertlehre in Einklang bringen kann. (Ich lasse jetzt mal Luxemburg aus.)
Geld mit einem Wert in Verbindung zu bringen ist vergleichbar mit der Geschichte von Gleichungssystemen, bei denen die Zahl der (unabhängigen) Gleichungen größer! ist als die Zahl der zu bestimmenden Variablen. Das hat ein bißchen was mit Sraffa zu tun, wo ja auch immer die Frage im Raum steht, wie der Freiheitsgrad des Produktionssystems gefüllt werden kann. (Die „Lösung“, den Freiheitsgrad dadurch zu schließen, indem man die Profitrate als exogen definiert, ist für meine Begriffe nicht befriedigend.)
Meine Vorstellung dabei ist, daß eine Konzeption von Geld als RELATIVES Maß des Produktionssystems es genau vermeidet, die Wertrelationen des Gütersystems überzubestimmen! Und genau deswegen DARF Geld keinen Wert haben, weil sonst eine Wertgröße zuviel existiert, die es verunmöglicht eine konsistente Lösung für das Produktionssystem zu erhalten.
Ich glaube, daß Sie mit dieser Antwort sogar etwas anfangen können!
Freundliche Grüße
Sehr geehrter Herr Menendez,
„Meine Vorstellung dabei ist, daß eine Konzeption von Geld als RELATIVES Maß des Produktionssystems es genau vermeidet, die Wertrelationen des Gütersystems überzubestimmen!“ Ich mache mir schon lange Gedanken in diese Richtung, obwohl ich weiss, dass ich als Nicht-Mathematiker scheitern muss. Nehmen wir, um meine Argumentation zu verdeutlichen, das Marx`sche Schema der einfachen Reproduktion:
I. 4.000 c + 1.000 v + 1.000 m = 6.000 Produktionsmittel
II. 2.000 c + 500 v + 500 m = 3.000 Konsumtionsmittel
und „optimieren“ wir es dahingehend, dass wir auf der 1.Stufe der Produktion die Produktionsmittel als Input herausnehmen. Zum Beispiel:
I. 1.000 v + 1.000 m = 2.000 Produktionsmittel
II. 2.000 c + 500 v + 500 m = 3.000 Konsumtionsmittel
Die Gleichgewichtsbedingungen lauten: 2.000c = 2000 Produktionsmittel und: 1.000v + 1.000m + 500v + 500m = 3000 Konsumtionsmittel. Was sehen wir hier? Arbeitswerte? Mitnichten! Oder besser: Nicht nur! Was Marx hier formuliert hat, sind Geldgleichungen, die wie folgt zu deuten sind: Der Produktionsmittelsektor verschuldet sich in der Höhe von 1000 GE um Arbeitskraft zu kaufen und 1.000 GE um den Gewinn auszuschütten. Der Lebensmittelsektor verschuldet sich zunächst in der Höhe von 2000 GE um die Produktionsmittel zu kaufen und dem Produktionsmittelsektor seine Entschuldung zu ermöglichen. Dann schiesst der Lebensmittelsektor eine Verschuldung in Höhe von 500 GE zum Kauf der Arbeitskraft zu und nochmals 500 GE um den Gewinn auszuschütten. Schlussendlich werden diese 3000 GE Konsumtionsmittel durch die Löhne des Produktionsmittelsektors (1000 GE) und des Lebensmittelsektors (500 GE) einerseits, durch die Gewinne der beiden Sektoren (1000 GE + 500 GE) andererseits, absorbiert. Alle Verschuldung ist eliminiert, das System ist im Gleichgewicht und kann sich auf gleicher Stufe reproduzieren.
Was lernen wir daraus? Erstens: dass die Marxsche Werttheorie zugleich(!) eine Geldtheorie ist, die die Geldströme abbildet. Dieses überraschende Ergebnis begründet sich dadurch, dass das Wertberechnungsverfahren, dass darin liegt, den Wert jeder Stufe mit der lebendigen Arbeitszeit auf der letzten Stufe zu addieren, exakt gleich abläuft wie die Schuldbereinigung der Vorstufen durch die Nachstufen. Also in unserem Beispiel: errechnet sich der Wert der Produktionsmittel durch die eingebrachte Arbeitszeit (1000v + 1000m) und der Wert der Konsumtionsmittel, indem man die dafür geleistete Arbeitszeit (500v + 500m) mit dem Wert der Produktionsmittel (2000) addiert. Genauso wie die Entschuldung abläuft, nämlich srufenmässig, addiert sich auch der Wert. Was lernen wir noch? Dass es tatsächlich so ist wie Sie, Herr Menendez, vermuten, dass nämlich das System eindeutig definiert ist. Denn bekanntlich hat die von Sraffa abgeleitete Interpretation der Marx`schen Werte: W mal A + l = W (mit W = Arbeitswerte, A = Input/Output-Matrix, l = Arbeitszeiteinsatz) im Gegensatz zu der Preisgleichung (P mal A + l) (1 + r)= P keinen Freiheitsgrad, der durch die Profitrate gefüllt werden muss.
Nur: Sind wir jetzt wirklich weitergekommen? Immerhin: Wir haben nur einen Formalismus entdeckt, der darin liegt, dass die Marx`schen Werte gleich berechnet werden wie die Geldwerte. Jedoch verliert die Input-Output-Matrix A bei der Bestimmung der Geldwerte jeglichen Sinn. Es sind NICHT die technischen Gegebenheiten, die die vorgeschossenen Geldeinheiten festlegen. Mit anderen Worten: Auch wenn Marx eine Geldtheorie formulierte, fehlt doch eine sinnvolle Interpretation der Matrix A um diese Geldtheorie mit Leben zu erfüllen. Natürlich könnte man ala Sraffa sagen: Diese Matrix ist vorgegeben. Nur: Was ist daraus gewonnen? Denn während die Input-Output-Matrix eine empirisch messbare Grösse ist, ist die Marxsche Matrix A ein „metaphysisches“ Produkt. Wir kommen hier in ein erkenntnistheoretisches Feld, das man beim besten Willen keinen Ökonomen überlassen kann.-) Ich für meinen Teil erkenne nichts Verwerfliches daran zu sagen: „Es bedarf soundsoviel Geldeinheiten zum Kauf der Ware 1, zum Kauf der Ware 2, etc. um eine physische Einheit der Ware 1 zu produzieren“. Nur: Ist es auch sinnvoll?
Mit freundlichem Gruss
Alfred Felsberger
Sehr geehrter Herr Felsberger,
ich bin ehrlich gesagt mit der „Beispielwillkür“ im Zuge der Diskussion über die Reproduktionsschemata ein bißchen verwirrt, weil irgendwie für mich nicht ersichtlich ist, welches die Prinzipien sind, welche dieses System leiten.
Gibt es eigentlich irgendwo eine Ausarbeitung zu diesem Thema, welche das moderne Hilfsmittel der Simulationssoftware verwendet, um der ganzen Sache mal einen grundsätzlichen Charakter zu verleihen? Es kann doch nicht sein, daß sich diese Diskussion in der Behandlung von singulären Einzelfällen erschöpft? Denn soweit es richtig wäre wie Sie sagen, daß die Reproduktionsschemata einen Geldkreislauf abbilden, müßte es doch möglich sein, diese mit Hilfe von Simulationssoftware zu modellieren, so daß man die Willkür – mal hier ein bißchen Veränderung und dann mal da – bei der Modelldiskussion zugunsten einer grundsätzlichen Modellkonstruktion entwickelt.
Da ich selbst derartige Modelle entwickelt habe könnte es durchaus möglich sein, diese Geschichte mal auf eine solide Grundlage zu stellen. Denn sobald man die Beziehungen zwischen den Variablen zweifelsfrei definiert sagt einem die Software, ob man konsistent gedacht hat oder nicht. Für eine solche Aufgabe würde ich schon mal in Österreich vorbeikommen.
Freundliche Grüße
Sehr geeherter Herr Menendez,
Sie sind jederzeit willkommen in Österreich! Ich lebe ohnehin an der Grenze zu Lindau/Bregenz am Bodensee, wo man auch mal Urlaub machen kann. Nur möchte ich ihnen keine Hoffnungen machen, dass hier ein Spezialist auf sie wartet.-) Ich bin weder Ökonom noch Mathematiker und schon gar nicht Softwareentwickler. Selbst die Kenntnis der Marxschen Theorie erschöpft sich auf eine eigenwillige Interpretation.-)
Zu ihrer Frage, welche Prinzipien das System der einfachen Reproduktion leiten: Zunächst die Gleichgewichtsbedingung, dass die Märkte geräumt werden müssen, dass also der Output jedes Sektors dem Input aller anderen Sektoren entspricht. Das ist der ganz normale Gleichgewichtsansatz der Sraffa-Welt. Bei Marx kommt jedoch hinzu, dass zusätzlich die Geldströme sich bereinigen müssen, dass also am Ende der Periode Entschuldung aller herrscht.
Gesucht ist nun auf Basis der Kenntnis der Technologie A, der gegebenen, vorgeschossenen Löhne und Gewinne (v + m), das Preissystem, das Gleichgewicht garantiert. Mit Wirklichkeit hat das sehr wenig zu tun, weil man ja die Kenntnis der Technologie A voraussetzt, die ja bekanntlich ein umfangreicher Datenkranz ist. Alles, was man mit diesem Modell sagen will, ist: dass die Preise eine Funktion der Technologie A und der Verschuldung (v + m) sind, nicht aber der Verteilung (m/v).
Das ist nun ein sehr überraschendes Ergebnis, wenn man es mit Sraffa kontrastiert und wo es einem Ökonomen die Haare aufstellen muss.-) Wie kann die Verteilung keinen Einfluss auf die Preise haben? Ganz einfach, weil Lohn und Gewinn völlig gleiche Einkommenskategorien sind. Beide werden über Verschuldung vorgeschossen, es ist unbedeutend, ob der Lohnanteil grösser ist oder der Gewinnanteil ist. Bedeutsam ist bloss die Gesamtverschuldung, nicht wie sie auf v + m verteilt ist.
Dahinter steht natürlich das Marx`sche Dogma, dass die Verteilung (v + m) schon lange festgelegt ist, bevor der Preisbildungsprozess beginnt. Marx dachte: im Arbeitsprozess. Es stellt sich jedoch heraus: durch den Geldvorschuss-Prozess. Was an Löhnen und Gewinnen ausgeschüttet wird, das ist die Verteilung! Die Preise, die sich bilden regeln nur mehr die Zuordnung zur (realen) unbekannte Beute wie Sie es ja auch in der Jessie James-Geschichte beschreiben.
PS: Ob ich richtig liege, weiss ich selbst nicht.-)
Mit freundlichem Gruss
Alfred Felsberger
Sehr geehrter Herr Menendez,
ich habe über die Bedingungen einer Preistheorie im Kontext einer Kredigeldökonomie noch einmal nachgedacht. Vielleicht finden Sie ja einen Mathematiker oder sind selbst mathematisch geschult genug um dieses „philosophische Set-up“ in ein Modell zu übersetzen. Ich kann es leider nicht.
1) Grundsätzlich: Es ist immer zwischen einer stationären Ökonomie und einer wachsenden zu unterscheiden. Die stationäre Ökonomie kennt nur eine Form des Gewinns, den ausgeschütteten, die wachsende Ökonomie jedoch zwei Formen: den ausgeschütteten Gewinn und den thesaurierten. Der ausgeschüttete Gewinn ist eine Stromgrösse, die über Entschuldung wieder eliminiert wird, der thesaurierte Gewinn jedoch ist die Veränderung einer Bestandsgrösse, die Verlängerung der Aktivaseite, die zu Wachstum in der nächsten Periode führt. Die Preistheorie in einem stationären Modell folgt daher der Forderung, dass alle Märkte physisch geräumt werden, während die Preistheorie einer wachsenden Kreditgeldökonomie genau das Gegenteil verlangt: dass die Märkte eben nicht geräumt werden, sodass ein Restprodukt bei den Unternehmen verbleibt, das sich auf der Aktivaseite als Bestandsgrösse sammelt. Von daher muss klar sein, dass ein gleichgewichtstheoretischer Ansatz zur Begründung einer Preistheorie nur in einem stationären Kontext möglich ist. Wachsende Ökonomien auf Kreditgeldbasis entziehen sich gleichgewichtstheoretischen Modellierungen, d.h. der Forderung nach Markträumung.
2) Das Argument, dass auch in einer wachsenden Kreditgeldökonomie das „Restprodukt“ der Unternehmen, das als thesaurierter Gewinn auftritt, untereinander getauscht und über Ver- und Entschuldung an die „richtige“ Stelle im Unternehmenssektor platziert wird, ist falsch. Der Irrtum wird offenbar, wenn man sich vergegenwärtigt, dass jeder Sektor einen thesaurierten Gewinn hat und zumindest ein Sektor ein Endprodukt erzeugt, das als Tauschpartner nur Konsumenten (also Arbeiter- und Kapitalistenhaushalte) findet. Was soll dieser Sektor mit seinem „Restprodukt“ machen? Kein anderer Unternehmenssektor wird ihn abnehmen, woraus aber folgt, dass zumindest ein anderer Unternehmenssektor ebenso auf seinem „Restprodukt“ sitzenbleibt, und daher ein weiterer und noch ein weiterer. Die Vorstellung eines simultanen Gleichgewichts bricht in sich zusammen, wenn nur ein Überschuss, nämlich der des Endprodukts, nicht absetzbar ist. In realiter werden Teile des theaurierten Gewinns getauscht und andere Teile eben nicht. Modelltheoretisch bedeutet es jedoch, dass man die Vorstellung einer simultanen Markträumung („Gleichgewicht“) im Kontext einer wachsenden Ökonomie fallenlassen muss.
3) Betrachtet man nun eine stationäre Ökonomie, dann müssen zu ihrer gleichgewichtigen Reproduktion zwei Bedingungen erfüllt sein: a) das physische Produkt muss geräumt werden und b) die Geldströme müssen sich über Entschuldung aufheben. Physische Reproduktion und geldbezogene Reproduktion verschränken sich ineinander und legen das Preissystem fest. Nach meinem Dafürhalten gibt es nur einen Zugang zu diesem Problem, nämlich den, den Marx in der „einfachen Reproduktion“ gewählt hat. Man muss die Input-Output Matrix so konstruieren, dass auf der untersten Produktionsstufe („Vorprodukt“) nur Arbeit eingeht, auf der nachfolgenden („Zwischenprodukt“) das Vorprodukt und Arbeit, und auf der letzten Stufe („Endprodukt“) das Zwischenprodukt und Arbeit. Der klassische Weg, den Output jedes Sektors als Input jedes anderen Sektors zu konstruieren, versagt, weil dann zwar Preise berechnet werden können, aber die Entschuldungsbedingung („Geldwert des Vorprodukts“ = „Geld-Input des Zwischenprodukts“) nicht eingehalten werden kann. Mit anderen Worten: ist die auf Grundlage von Sraffa abgeleitete Marx`sche Wertheorie nicht in der Lage Entschuldung zu leisten.
4) Das so festgelegte Preissystem ist kein System der relativen Preise mehr. Es ist ein System absoluter Geldwerte, wo jedem Produkt eine Zahl zugeordnet ist (z.B.: 3 Geldeinheiten), genauso wie die Marxsche Werttheorie absolute Arbeitszeiten zuordnet (z.B.: 3 Arbeitsstunden). Man kann sich die Konstruktion dieses Preissystems wie folgt vorstellen: auf der untersten Stufe („Vorprodukt“), auf der nur Arbeit eingeht, wird Lohn und Gewinn über Verschuldung ausgeschüttet. Diese Grössen sind gegeben, sodass auch der Geldwert des Vorprodukts gegeben ist: Er errechnet sich, indem man die gegebenen Zahlungsströme (Lohn und Gewinn) durch die Anzahl der produzierten Einheiten des Vorprodukts dividiert. Dieser Geldwert, der Verschuldung darstellt, geht dann in die Produktion des Zwischenprodukts ein und wird solcherart über Entschuldung eliminiert. Diesem Zwischenprodukt wird wieder Verschuldung, also Lohn und Gewinn, hinzugefügt und dann über Verkauf an den Endsektor beseitigt. Dieses Verfahren ist völlig analog zur Bestimmung der Marxschen Arbeitswerte. Bei ihm werden auf jeder Stufe Arbeitszeiten hinzugefügt, hier: Verschuldung (Lohn + Gewinn).
5) Zu klären bleibt, wie es dazu kam, dass die Ökonomen (und Marx selbst) bei der Bestimmung dieses Preissystem den Ausgleich der Profitraten verlangten, wo doch das von ihm formulierte Preissystem allen wesentlichen Bedingungen, Räumung der Märkte und Entschuldung, genügt. Die Antwort kann nur sein: Weil sie eben niemals im Kontext einer Kreditgeld-Ökonomie dachten, sondern immer nur in Tauschkategorien (relative Preise). Marx hat durch Zufall nicht die Lösung (dies deshalb: weil er den untersten Sektor, den Lebensmittelsektor, mit c>0 ausstattet, was zu keiner Lösung führen kann), sondern das Verfahren gefunden, das der Lösung zugrundeliegt: die Werttheorie. Er hatte aber keine Ahnung davon, was er hier eigentlich gefunden hat. Sein Hausverstand hat ihn die Geldströme so konstruieren lassen, dass sie stimmen, und das ist eine grossartige Leistung. Die Ökonomen nach ihm, seine grössten Kritiker, haben nie wieder in Geldströme gedacht. Das ganze sinnlose Gerede über den Ausgleich der Profitrate dokumentiert nur: dass sie keinen Tau von aboluten Geldwerten haben, dass ihnen völlig die Vorstellung davon fehlt: dass die Verschuldung (Lohn + Gewinn) das Preissystem bestimmt.
Mit feundlichem Gruss
Alfred Felsberger
Provokant gesagt: wenn es tatsächlich so ist wie ich vermute, dass die Marxsche Werttheorie die einzige Geldtheorie ist, die jemals widerspruchsfrei formuliert wurde, wie von einer Mathematiker-Generation hinreichend bewiesen, dann erscheint auch das Transformationsproblem in einem neuen Licht. Das zu transformierende System ist nicht Marx sondern Sraffa! Letzterer muss beweisen wie er zu Marx überleitet, und nicht umgekehrt! Freilich ändert sich nichts daran, dass das Transformationsproblem nicht lösbar ist, dass also nach wie vor das Bonmot Samuleson`s gilt: „Betrachte zwei alternative, widersprüchliche Systeme. Schreibe das eine hin. Zur Transformation nimm` einen Radiergummi und radiere es aus. Schreib dann stattdessen das andere hin. Voilà! Damit ist der Transformationsalgorithmus beendet.“ Nur die Unmöglichkeit des Verfahrens gewinnt eine neue Dimension und Interpretation: Es ist unmöglich aus den Sraffa`schen Preisen die Marxschen Geldwerte abzuleiten. Deshalb: Vergessen wir`s! Schütten wir Sraffa in den Orkus (wie einst die Sraffianer von Marx verlangt haben)!
Alfred Felsberger, der leider kein Mathematiker ist und daher nur in Vermutungen sich ergeht-)
Eine Korrektur und Anmerkung: die Marxsche Matrix A würde natürlich die Geldeinheiten zum Kauf der Ware 1, 2, etc. angeben, die notwendig sind um eine Geldeinheit der Ware 1 (und nicht physische Einheit!) zu produzieren. Und insofern taucht hier tatsächlich das alte Problem auf: Input- und Outpreise vergleichbar machen zu müssen, wo doch Zeit zwischen den beiden Punkten liegt. Jedoch handelt es sich hier nicht um eine prinzipielle Unvergleichbarkeit, denn gerechnet wird in Geldeinheiten, sondern bloss um eine faktische. Die Wirklichkeit stemmt sich dagegen, nicht die Mathematik.
Alfred Felsberger
Pingback: Geldschöpfung als Quantenfluktuation - Iromeisters Abenteuerreise
Gerade verbloggt: http://www.iromeister.de/geldsch%C3%B6pfung-als-quantenfluktuation
Sehr geehrter Herr Ollech,
Nur der Staat definiert, ob Zentralbankengeld „Sache“ oder „Kredit“ ist. Er alleine hat die Macht dies zu tun und kein Kommentator wird ihn daran hindern. Erhebt der Staat das Zentralbankengeld zur „Sache“, hat er gleichzeitig entscheiden, dass es keinen Wert hat und weder er noch die Zentralbank in Konkurs gehen können. Belässt er es als Kredit, hat sich das Zentralbankengeld und die Staatsschuld dem gleichen Verfahren zu fügen wie jeder andere Kredit auch: Es wird abgeschätzt, ob er bedienbar ist oder nicht. Ich bin sehr erstaunt, dass nach dem „Schuldenschnitt“ in Griechenland dies noch nicht ins europäische Bewusstsein gedrungen ist und noch immer Leute behaupten, dass Zentralbankengeld „Sache“ sei. Genau dort wurde es nämlich als Kredit behandelt, indem sich die EZB geweigert hat, die Staatsschuld Griechenlands in Zentralbankengeld zu übersetzen: Keine beliebige Vermehrbarkeit, daher keine Sache, daher Kalkulation von Bonität, daher Konkurs von Griechenland. Das ist die Kausalität, mit der wir Europäer konfrontiert sind, und die niemand so recht zur Kenntnis nehmen will. Anders gesagt: Die europäischen Staaten haben entschieden, dass, anders als im Rest der Welt, Zentralbankengeld Kredit sei, daher einen inhärenten Wert hat, der sich an der Bedienbarkeit des Kredits misst.
Mit freundlichem Gruss
Alfred Felsberger